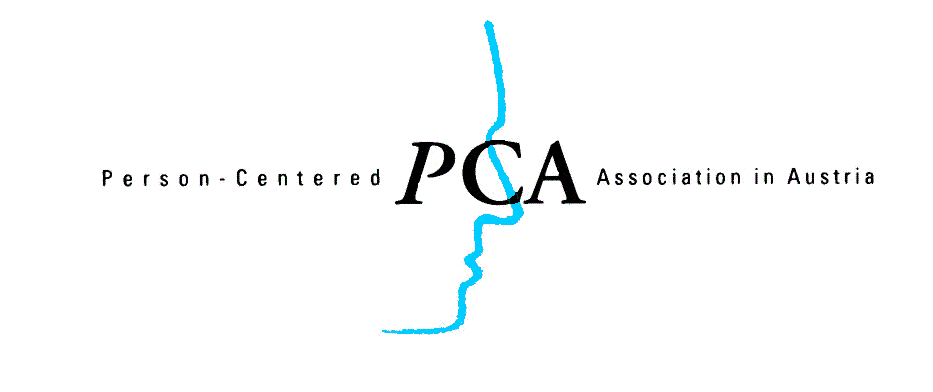
Störungsspezifische Ansätze ?
Ute Binder, Christian Fehringer, Jobst
Finke, Peter F. Schmid, Hermann Spielhofer
Subsymposium der
PCA
beim Symposium
“Gestaltende und vermittelnde Prozesse. Selbstorganisation
in Personzentrierter Beratung und Psychotherapie"
Salzburg, 17.-19. September 2004
Abstracts

Ute Binder, Frankfurt/M.
Störungsspezifische Verstehensprozesse versus
diagnosegeleitete Einstellungen
Der Beitrag vergleicht störungsspezifische
Verstehensprozesse, die im Personzentrierten Ansatz zentral mit dem
Empathiekonzept verbunden sind mit diagnosegeleiteten Einstellungen und den sich
hieraus ergebenden Konsequenzen für therapeutisches Vorgehen. Es wird
herausgearbeitet, dass beide Ansätze von der Voraussetzung ausgehen, dass die
Beschäftigung mit und Kenntnis über Störungen - theoretisch, empirisch
gewonnen oder auch erfahrungsbezogen - eine notwendige, gewinnbringende
professionelle Grundbedingung darstellt. Sie ermöglicht kollegialen Diskurs,
Forschung und Erkenntniszuwachs. Dies entspricht dem legitimen Anliegen von
Patienten, aufgrund ihres erlebten Leidens bzw. ihrer Störung diagnostizierten
Probleme wegen Hilfe bei einem Experten zu suchen. Hierdurch ergeben sich
zahlreiche formale Parallelen und vergleichbare Erfahrungen. Anliegen meines
Beitrages ist es, die zentralen Unterschiede dieser Blickrichtungen hinsichtlich
Beziehung, Menschenbild, Zielsetzung und professioneller Überzeugung heraus zu
arbeiten und deutlich zu machen, dass hier Verschiedenheiten bis hin zu
grundsätzlicher Inkompatibilität bestehen.
Christian Fehringer, Wien
Wieviel Störungswissen ist nötig, um personzentriert arbeiten zu können?
Oder: Wann brauche ich welches Wissen für wen und wozu?
Die Idee, theoretische Konstrukte seien in der Praxis
direkt anzuwenden und umsetzbar, um "die Sache in den Griff zu kriegen", ist
illusorisch. Wo es um die Unberechenbarkeit nichtlinearer, komplexer, doppelt
kontingenter Beziehungsdynamik geht, ist hinsichtlich instruktiver
Interventionen Bescheidenheit geboten. Wenn klinisches Handeln sich auf
technologische Regeln stützt, wird außer acht gelassen, dass es in einer
psychosozialen Praxis darum geht, mit lebenden Personen, die einer je eigenen
Selbstorganisation unterliegen, zu verhandeln, deren Verhalten als Ergebnis
einer inneren Dynamik sich ständig in nicht prognostizierbarer Weise verändern
kann. Psychotherapie gehört daher nicht nur der Medizin. Die Themen der
Psychotherapie sind zu einem hohen Anteil Themen die in der Philosophie
beheimatet sind und auch philosophisch verhandelt werden sollten. Therapeutische
Praxis hat eine philosophische Dimension, die, um die medizinische Leitmetapher
zu erwähnen, was anderes meint als "Krankheit" zu bekämpfen. Die Ausgliederung
von Psychotherapie aus dem medizinischen Kontext kann für unseren
Arbeitsbereich einen enormen Verselbständigungsschub bewirken. Weiters ist die
Frage zu diskutieren, ob denn über das "Seelische" in einer
naturwissenschaftlichen Fachsprache überhaupt gesprochen werden kann, oder ob
über diesen Bereich nur in Form von Metaphern erzählt werden kann.
Jobst Finke, Essen
Beziehung und Technik –
Die polare Struktur von Psychotherapie als Herausforderung
für den Personzentrierten Ansatz
Wenn im Personzentrierten Ansatz die Bedeutung der
therapeutischen Beziehung betont wird, ist hier meist eine Beziehungsform
gemeint, in der der Therapeut als Teilnehmer eines Kommunikationsprozesses
fungiert, in dem es um gegenseitige Verständigung geht. Dabei ist zu fragen, ob
der Therapeut auch eine Beobachter-Perspektive einnehmen kann und soll, die ihm
die Aufgabe des Urteilens und zielgerichteten Behandelns zuweist. Radikalisiert
man beide Aspekte, so ließe sich eine strikt beziehungsgeleitete,
verständigungsorientierte Position einer strikt technikgeleiteten, zweckrational
änderungsorientierten Position gegenüberstellen. Die „störungsspezifische
Gesprächspsychotherapie“ will diese Polarität nicht undialektisch auseinander
fallen lassen, sondern Psychotherapie als Verschränkung von Beobachter- und
Teilnehmer-Perspektive konzipieren.
Dabei unterstellt sie
ein Wechselverhältnis von Störung und Persönlichkeit
und definiert dieses so, dass sich für jede Störung idealtypische
Schlüsselthemen beschreiben lassen. Die personzentrierte Bearbeitung der mit
diesen Themen erfassten unterschiedlichen Problembereiche setzt ein Oszillieren
zwischen unterschiedlichen Perspektiven und Beziehungsangeboten voraus.
Peter F. Schmid, Wien
Kreatives Nicht-Wissen
Zu Diagnose, störungsspezifischem Vorgehen und zum
gesellschaftskritischen Anspruch des Personzentrierten Ansatzes
Vertragen sich Diagnosen mit dem Menschenbild und den
Grundlagen des Personzentrierten Ansatzes? Ist Störungs–spezifisches Denken und
Handeln eine Weiterentwicklung oder eine Wegentwicklung von Person–orientierter
Therapie? Wenn ja, worin besteht dann das Charakteristikum des PCA, das ihn
unverwechselbar macht und Grund für seine Eigenständigkeit ist? Wenn nein, wie
soll der PCA dann in einem Gesundheitssystem und einer Gesellschaft erfolgreich
überleben, die solche Forderungen aufstellt – oder sollen wir uns damit
begnügen, die Rolle einer kleinen radikalen, aber unbedeutenden Minderheit zu
spielen? Diesen und verwandten Fragen soll in Referat und Diskussion grundlegend
nachgegangen werden.
Rogers’ Persönlichkeitstheorie erweist sich bei näherem Zusehen als herbe
Gesellschaftskritik. Unter anderem wandte er sich gegen die Vorstellung, es
seien die Interventionen von ExpertInnen, die die Wirkung von Psychotherapie
ausmachen. Impliziert sein Konzept, „dass die wesentlichen Bedingungen der
Psychotherapie“ in einer einzigen Konfiguration bestehen, selbst wenn der Klient
sie sehr verschiedenartig anzuwenden vermag“ (1957) tatsächlich, wie seither
oft behauptet, die Ablehnung von Störungsdifferenzierung und Diagnose? Oder
anders gefragt: Haben wir durch die seither zahlreich entwickelten
differenziellen Konzepte wirklich Neues über die KlientInnen und die
therapeutische Beziehung dazugelernt?
Aus personaler, dialogischer Sicht sind TherapeutIn und KlientIn nicht nur in
Beziehung, sie sind Beziehung. Das bedeutet, dass sie in jeder therapeutischen
Beziehung verschieden sind. Empathieorientierte (im Gegensatz zu
interventionsorientierter) Therapie, beruht auf einen erkenntnistheoretischen
Paradigmenwechsel, der eine fundamentale Gegenposition zu den traditionellen
Vorstellungen von Diagnose und Klassifizierung mit sich bringt: Es ist der
Klient bzw. die Klientin, der sein/ihr Leben und die Bedeutung seiner/ihrer
Erfahrungen bestimmt und so den Therapeuten bzw. die Therapeutin „in-form-iert“,
das heißt in Form bringt zu verstehen. Therapeut bzw. Therapeutin sind nichts
weniger als herausgefordert zu riskieren, durch ‚co-experiencing’,
‘co-constructing’ und ‘co-responding’ gemeinsam mit dem Klienten bzw. der
Klientin eine einzigartige Beziehung zu erschaffen. Es ist immer die Orthopraxie,
die die Orthodoxie herausfordert.
Hermann Spielhofer, Wien
Selbststruktur bei narzisstischen Störungen und Borderline-Persönlichkeiten
Das Selbst als Bild der eigenen Person und ihrer
Beziehungen zur Umwelt ist das Resultat der Interaktion des Organismus mit der
Umgebung und den dabei ins Spiel kommenden Bewertungen. Bereits in einem früher
Stadium, während der Mutter-Kind-Dyade bildet das Kleinkind nicht-verbale,
unbewusste Konzepte über sich und seine Beziehung zur Umwelt, gleichsam als
Vorläufer eines Selbstkonzepts. Diese vorerst vagen Fragmente erweitern sich bei
einer stabilen Fürsorge und einfühlsamen Zuwendung zu Repräsentanzen der eigenen
Person und der Beziehungen zu den primären Bezugspersonen und verschmelzen in
der Folge zu einem konsistenten Selbstbild.
Wichtig für die Ausbildung eines stabilen Selbst ist die
positive Beachtung des kindlichen Erlebens durch die Bezugspersonen, dessen
Einbindung in die gemeinsame Kommunikation und Symbolisierung. Erst dadurch wird
eine Integration dieses Erlebens in das Selbst möglich sowie eine angemessene
Differenzierung des Wahrnehmungs- und Erlebnisfeldes und eine klare Trennung der
eigenen Person, des „Mich“ von den Bezugspersonen. Wenn es in dieser frühen
Phase zu starken Entbehrungen kommt und das Kind widersprüchlichen verbalen und
non-verbalen Botschaften der Erwachsenen ausgesetzt ist, wird die Ausbildung
eines stabilen und kohärenten Selbstbildes erschwert und wesentliche
Erlebensbereiche bleiben der Selbsterfahrung unzugänglich. Es entsteht eine
instabile, fraktionierte Selbststruktur mit einander widerstrebenden Anteilen.
Dadurch bleibt die Person frühen Abwehrformen wie Verleugnung, Idealisierung,
Abspaltung oder Projektion verhaftet und es kommt zu widersprüchlichen und
impulsiven Verhaltensweisen, wie wir es insbesondere bei narzisstischen
Störungen und Borderlinestrukturen kennen.

© Peter
F. Schmid pfs 2004
 Workshop
"Personzentrierte Aufstellungsarbeit" - Peter F. Schmid, Salzburg Symposium 2004
Workshop
"Personzentrierte Aufstellungsarbeit" - Peter F. Schmid, Salzburg Symposium 2004
 Symposium Salzburg 2004
Symposium Salzburg 2004
 Was ist die PCA?
Was ist die PCA?  Information in
English
Information in
English
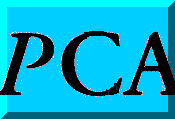 Zur PCA-Titelseite | PCA Mainpage
Zur PCA-Titelseite | PCA Mainpage
 Zur Hauptseite Peter F. Schmid
Zur Hauptseite Peter F. Schmid  Zum Seitenanfang | Top of page
Zum Seitenanfang | Top of page
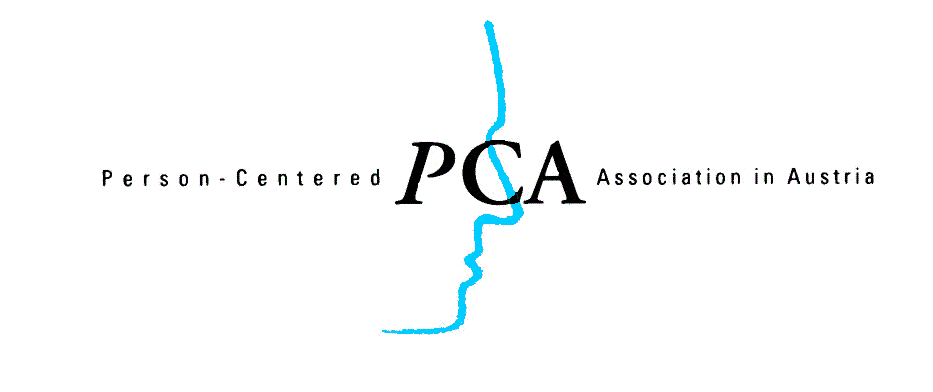
![]()
![]()
![]() Workshop
"Personzentrierte Aufstellungsarbeit" - Peter F. Schmid, Salzburg Symposium 2004
Workshop
"Personzentrierte Aufstellungsarbeit" - Peter F. Schmid, Salzburg Symposium 2004![]() Symposium Salzburg 2004
Symposium Salzburg 2004![]() Was ist die PCA?
Was ist die PCA? ![]() Information in
English
Information in
English![]() Zur PCA-Titelseite | PCA Mainpage
Zur PCA-Titelseite | PCA Mainpage
![]() Zur Hauptseite Peter F. Schmid
Zur Hauptseite Peter F. Schmid ![]() Zum Seitenanfang | Top of page
Zum Seitenanfang | Top of page